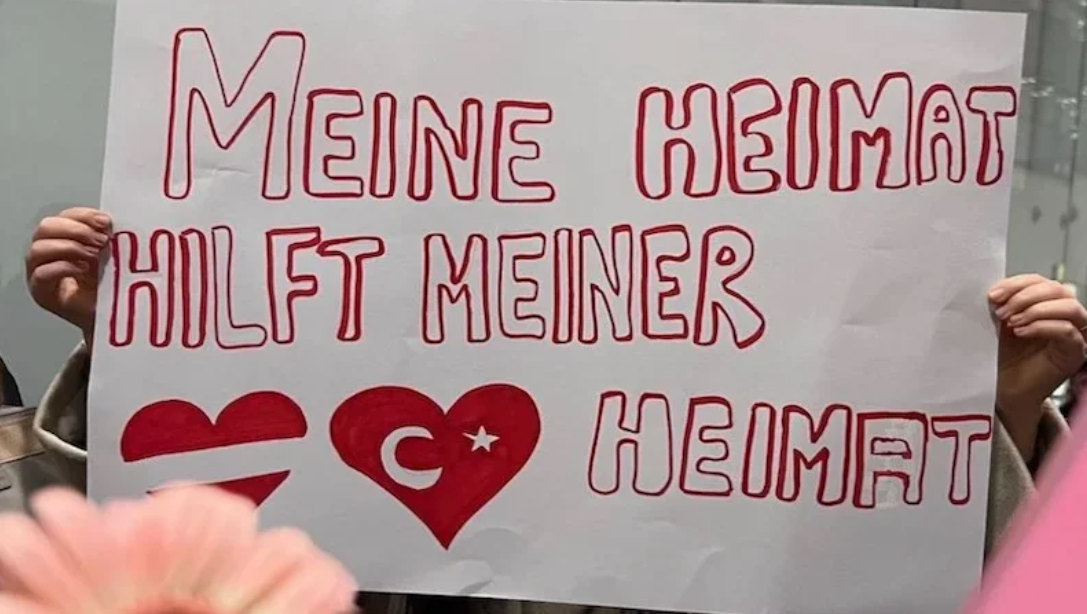Mit Prämien ködern, mit Überstunden gegeneinander antreten lassen | Leistungsdruck durch Strafen bei den Wiener Linien

Die Ticketkontrolleur*innen, im Volksmund als „Schwarzkappler“ bekannt, sind das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs in Wien. Doch ihre Arbeitsbedingungen sind weitaus komplexer und umstrittener, als es der Öffentlichkeit oft bewusst ist. Besonders das Prämiensystem und die Regelungen zu Überstunden schaffen unter den Beschäftigten Ungleichheit und fördern Konkurrenzdenken.
Anmerkung von Der Virgül:
Die Stadt Wien unternimmt keine konkreten Schritte in Richtung eines kostenlosen öffentlichen Verkehrs. Stattdessen drängt sie die Kontrolleure mit einem System aus Prämien und Quoten in eine auf Strafen basierende Wettbewerbssituation. Öffentliche Dienstleistungen sollten nicht durch Leistungsdruck und Anreize, sondern durch Zugänglichkeit gemessen werden.
7,30 Euro Prämie pro Schwarzfahrer – aber nicht für alle
Laut dem von den Wiener Linien bestätigten und öffentlich zugänglichen Kollektivvertrag erhalten Kontrolleure pro erwischtem Schwarzfahrer eine Prämie von 7,30 Euro. Ab einer bestimmten Anzahl steigt dieser Betrag jedoch:
- Ab dem 317. Fall verdoppelt sich die Prämie (100 % Erhöhung),
- ab dem 417. Fall erhöht sie sich um 150 %.
Doch ein entscheidender Punkt: Zahlt der ertappte Fahrgast die Strafe nicht innerhalb von sechs Wochen, geht die Prämie für den Kontrolleur verloren.
Überstunden abhängig von Strafanzahl
Nicht nur Prämien, auch das Recht auf Überstunden ist an die Anzahl der verhängten Strafen gekoppelt. Laut dem ehemaligen Gewerkschafter Herbert Weidenauer dürfen Kontrolleure, die im Quartal keine etwa 150 Strafen schreiben, keine Überstunden machen. Die Wiener Linien verteidigen diese Praxis in der Zeitung KURIER als „leistungsbezogen“. Doch wie genau Leistung gemessen wird, bleibt unklar.
Krankheit und Störungen zählen nicht zur Quote
Ein weiterer kritischer Punkt des Systems: Krankheitsfälle oder außergewöhnliche Situationen werden nicht berücksichtigt. Kontrolleure, die krankheitsbedingt keine Strafen ausstellen können, werden trotzdem an denselben Quoten gemessen. Gleichzeitig gehört es auch zu ihren Aufgaben, etwa bei technischen Störungen in der U-Bahn, Fahrgäste zu informieren – in solchen Momenten ist das Ausstellen von Strafen gar nicht möglich.
Gleiche Uniform, ungleiche Einkommen
Während manche Beschäftigte durch Prämien ihr Einkommen um 400 bis 500 Euro im Monat aufstocken, müssen sich andere mit dem Grundgehalt begnügen, weil sie die Quote nicht erreichen. Dieses liegt bei einem Bruttomonatslohn von 2.579,25 Euro – für viele, insbesondere mit Familie, nicht ausreichend. Ein anonymer Mitarbeiter berichtet, dass einige Kolleg*innen bis zu 100 Überstunden pro Monat leisten und aufgrund von Wohnkrediten auf dieses Zusatzgeld angewiesen seien.
Teamgeist wird durch Konkurrenz ersetzt
Gewerkschaftsvertreter kritisieren, dass dieses System nicht den Zusammenhalt, sondern den Konkurrenzkampf unter den Mitarbeiter*innen fördert. Herbert Weidenauer sagt dazu: „Die Wiener Linien sollten sich fragen: Wollen sie wirklich Strukturen aufrechterhalten, die Eifersucht und Unfrieden in der Belegschaft schüren – oder geht es ihnen um den Erhalt des Arbeitsfriedens?“
Leistungsdruck durch Strafensystem im öffentlichen Dienst
Dass ein öffentliches Unternehmen seine Beschäftigten aktiv dazu motiviert, möglichst viele Strafen zu verhängen, sollte aus Sicht der Stadtregierung, der Gewerkschaften und des öffentlichen Gewissens kritisch hinterfragt werden. Wenn der „Erfolg“ im öffentlichen Verkehr daran gemessen wird, wie viele Menschen bestraft werden, kann dies langfristig nicht nur die psychische Gesundheit der Angestellten belasten, sondern auch das Vertrauen der Fahrgäste in das System untergraben. | © Der Virgül