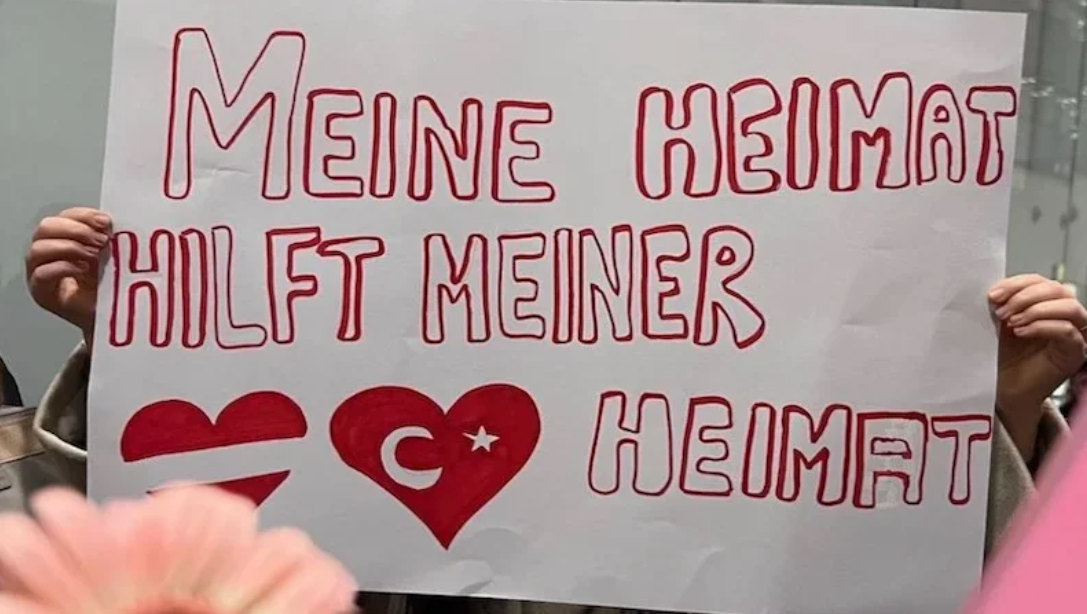Von Telefonzellen zu Videoanrufen: Die Kommunikationsreise der Migrant:innen

| Adem Hüyük
Dieser Artikel entstand aus meinem Besuch bei Özden Çelik in seinem Parfümladen auf der Favoritenstraße. Özden ruft mich jeden Tag unermüdlich an, um nach meinem Befinden zu fragen. Während unseres heutigen [Freitag]-Treffens war das Gespräch so sehr auf Entwicklungen konzentriert, die wir vorhergesehen hatten, dass wir den Regen um uns herum kaum bemerkten. „Komm, lass uns nicht nass werden, wir gehen unter das Dach dieser beiden Telefonzellen“, schlug Özden vor. Für einen Moment sahen wir uns an – wir dachten offenbar dasselbe. Wir waren in denselben Jahren nach Österreich gekommen und hatten dieselben Sehnsüchte erlebt.
„Erinnerst du dich, Özden, vor diesen Telefonzellen bildeten sich immer Schlangen? Wenn einmal die Leitung ausfiel, mussten wir es immer wieder versuchen.“ Unsere Erinnerungen reichten zurück bis in die frühen 1990er Jahre – doch die Suche nach Verbindung begann oft schon vor 1980. Manche von uns hatten in den Häusern ihrer Eltern keinen Telefonanschluss. Dann riefen Nachbarn an, und wir mussten hoffen, dass sie das Gespräch nicht beendeten. Denn einmal aufgelegt, konnte es Stunden dauern, bis wir wieder durchkamen.
Mit 100 Schilling in der Tasche hörten wir in diesen kleinen Kabinen die Stimmen unserer Lieben – eine Kraftquelle, die half, die Distanz zu überwinden. Manchmal schickten wir auch zerknitterte Briefe, doch das gesprochene Wort war unschlagbar. Wer vor mehr als 25 Jahren nach Österreich kam, kennt das Gefühl: jede Telefonzelle war ein Fenster in die Heimat. Heute sind diese Begegnungen durch Videoanrufe ersetzt. Technologie hat vieles vereinfacht, aber auch das Gefühl einer durchlebten Sehnsucht verändert.
Telefonzellen: Stille Zeugen der Migration
In Wiens Bahnhöfen und an den Ecken migrantischer Viertel standen einst gläserne Telefonzellen. In kalten Wintern warteten Menschen mit ein paar Münzen in der Hand hinter beschlagenem Glas, um ihre Stimmen in ferne Heimatländer zu senden. Für türkische Arbeiter:innen waren diese Kabinen oft die einzige Verbindung nach Hause. Kurze Gespräche wie „Hallo, wie geht es euch? Sind die Kinder wohlauf?“ dauerten nur so lange, wie das Geld reichte. Stundenlanges Warten in der Schlange, dann der Moment am Apparat – die ganze Sehnsucht lag in der Stimme. Oft blieben Worte ungesagt, Stimmen zitterten, Sätze verstummten.
Heute verschwinden diese Kabinen zunehmend. Ihre Plätze haben die leuchtenden Bildschirme von Smartphones eingenommen. Nun erreichen sich nicht nur Stimmen, sondern auch Gesichter. Enkelkinder sehen ihre Großeltern, Mütter schicken sofort Nachrichten an ihre Kinder. Was früher begrenzt und kostspielig war, ist heute Alltag. Doch die Telefonzellen bleiben als stille Zeugen der Geduld, Einsamkeit und Sehnsucht einer ganzen Generation im kollektiven Gedächtnis.
Die Entwicklung der mobilen Kommunikation in Österreich
Die mobile Kommunikation begann in Österreich offiziell 1974 mit dem B-Netz. Dennoch waren die Telefonzellen lange Zeit das wichtigste Kommunikationsmittel für viele Migrant:innen. Besonders in den 1970er und 1980er Jahren waren sie der einzige Weg, die Sehnsucht nach der Heimat zu stillen. Vor den Automaten, in die kleine Münzen, Token oder Prepaid-Karten gesteckt wurden, bildeten sich lange Schlangen. Jede Minute hatte ihren Preis, Gespräche beschränkten sich auf wenige Sätze: „Mir geht es gut“, „Ich habe das Geld geschickt“, „Wie geht es den Kindern?“
Heute hat sich die Situation grundlegend geändert. Dank günstigerer Tarife, internetbasierter Apps und mobiler Geräte ist die Welt kleiner geworden. Migrant:innen kommunizieren nicht mehr nur per Stimme, sondern auch per Video; Enkelkinder sehen ihre Großeltern auf dem Smartphone. Telefonzellen verschwinden aus den Straßen – für die junge Generation sind sie fast schon Museumsstücke. Dennoch bleiben sie als nostalgischer Bestandteil des gesellschaftlichen Gedächtnisses und stille Zeugen des Kommunikationskampfes der Migrant:innen unvergessen.| ©DerVirgül