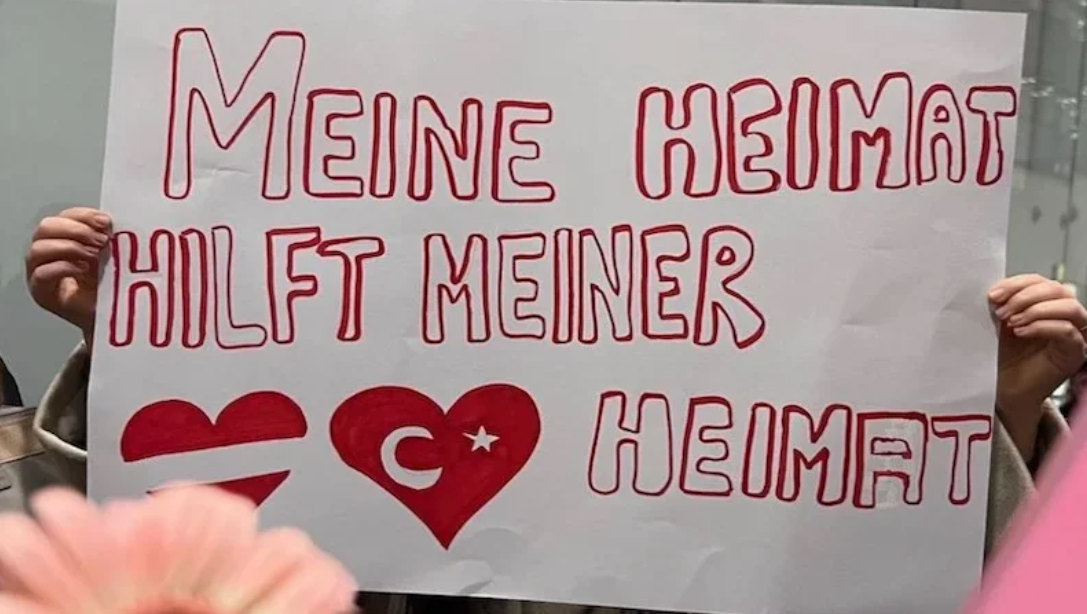Weiße Türken und Gastarbeiter

| Adem Hüyük
Die Kinder des türkischen Bürgertums, die für ihr Studium nach Österreich kommen – oft als „Weiße Türken“ bezeichnet –, sehen die hier lebenden 320.000 Menschen mit türkischem Migrationshintergrund nicht als Teil der österreichischen Gesellschaft. Vielmehr blenden sie sie aus oder betrachten sie als „minderwertig“.
In den 2010er Jahren arbeitete ich rund eineinhalb Jahre im Rahmen eines Renovierungsprojekts an der Technischen Universität Wien [TU Wien]. Im Labor war ich als Vorarbeiter tätig und arbeitete inoffiziell fast zwölf Stunden täglich. Da ich sehr gesprächig bin, hielten mich einige Studierende aus der Türkei zunächst für einen Universitätsdozenten – tatsächlich war ich für die Installationen im Labor zuständig.
Meine Identität habe ich nie verschleiert. Doch ich betonte stets, wie wichtig es ist, die Werke von Goethe, Nietzsche, Freud, Hegel, Marx und vielen anderen Philosophen im Original zu lesen. Übersetzungen sind niemals neutral; sie spiegeln immer die subjektiven Überzeugungen und Gefühle des Übersetzers wider. Entfernt man sich von der Originalsprache, entsteht eine Unsicherheit – ähnlich wie bei der Frage, ob die Lehren des Sokrates tatsächlich von ihm selbst oder durch Platon überliefert wurden.
Studierende, die mir stundenlang über Hegels dialektische Methode zuhörten, hörten plötzlich auf, wenn sie erfuhren, dass ich Arbeiter war. Denn es ging nicht um Wissen, sondern um Klasse und Status. Einige türkische Studierende stempelten Gastarbeiter pauschal als „ungebildet“ ab. Besonders der 10. Bezirk in Wien galt für sie als „Ghetto“, das man besser meidet.
Doch die gleichen Personen, die sich überlegen gaben, wurden oft selbst von einem gewöhnlichen österreichischen Kellner herabgesetzt. Ramazan Yaylalı beschreibt dies treffend in Der Virgül: Ein Gastdozent der Universität Wien sitzt im MQ, und der Kellner fragt spöttisch: „Soll ich Ihnen eine Shisha und einen Kebab bringen? Passt doch gut bei diesem Wetter.“ Trotz akademischem Status und kulturellem Kapital entkommt der Dozent dem Blick des „Anderen“ nicht – und wendet denselben Blick später auf die Migranten in Wien.
Auf einer Ausstellung trafen meine Freunde und ich gezwungenermaßen auf Vertreter dieses Bürgertums. Schon ihr Blick vermittelte eine klare Klassenüberlegenheit. Was wie individuelle Arroganz wirkt, ist in Wirklichkeit Ausdruck von Bildung, kulturellem Kapital und sozialem Status.
Natürlich gab es Ausnahmen. Einige Dozenten aus der Türkei waren bemerkenswert bescheiden, andere wiederum verhielten sich so herablassend, dass es einem Wissenschaftler unwürdig erschien. Herabgesetzt zu werden und als „ungebildet“ abgestempelt zu werden, entfachte in mir immer den Drang, mein Gegenüber mit Wissen zu konfrontieren. Vielleicht ist dies der Grund, warum ich so leidenschaftlich Bücher studierte.
Doch die schärfste Kritik erhielt ich von meinem Sohn Deniz Hüyük.
Er sagte:
„Baba, du hast jahrzehntelang den Marxismus bedingungslos verteidigt, während du die Realität der Türkei mit schematischer, opportunistischer ideologischer Zentralismusbrille betrachtet hast – bewusst oder unbewusst. Die 1970er-Bewegungen, die du verteidigt hast, waren wissenschaftlich gesehen nicht marxistisch.
Selbst wenn das Kapital ins Türkische übersetzt wurde, reicht es nicht aus, nur den Text zu lesen, um zu verstehen, wie er im bestehenden System Bedeutung erlangt, wie diese Bedeutung in gesellschaftlichen Kampf umgesetzt wird und welche Qualität die gesellschaftliche Evolution hat. Man muss die sozialen Bedingungen, Klassenverhältnisse und historischen Prozesse bewusst analysieren.
Die studentische Bewegung akzeptierte Marxismus über ideologische Reduktionen wie Leninismus, Maoismus und Trotzkismus. Deshalb kannst du die Realität Stalins nicht akzeptieren und versuchst, die Gräueltaten Stalins mit einer falschen marxistischen Perspektive zu rechtfertigen. Dabei erkennst du nicht, dass der Marxismus weit entfernt von diesen Reduktionen eine eigenständige philosophische Strömung ist…“
Dank ihm begann ich, vieles, das ich 30 Jahre lang für richtig gehalten hatte, neu zu hinterfragen.
Später entwickelte er aus der von mir erlernten philosophischen Denkweise eigene Schlüsse und begann, mich zu kritisieren. In Diskussionen mit Akademikern aus der Türkei stellte er provokativ die Frage:
„In welcher Sprache können wir philosophisch diskutieren außer Türkisch? Französisch, Deutsch, Englisch – welche wählen wir? Über die Industrielle Revolution auf Deutsch, Französisch oder Englisch?“
Mit diesen Fragen entlarvte er das Klassenbewusstsein jener, die Gastarbeiter vorschnell als „ungebildet“ abtaten.
Diese kleine, aber bedeutende Erfahrung auf der Ausstellung erinnert uns: Unsere Erfolge sollten nicht dazu dienen, andere kleinzumachen, sondern um einander zu stärken. Wofür nutzen wir unsere Errungenschaften – um andere zu erniedrigen oder um gemeinsam stärker zu werden?
Vergessen wir nicht: Wenn eine Gesellschaft in Unwissenheit gehalten wird, bedeutet das nicht, dass sie diese akzeptiert. Keine Gesellschaft will freiwillig ungebildet bleiben. Sobald sie sich dessen bewusst wird, hat sie bereits den ersten Schritt aus der Unwissenheit getan…| ©DerVirgül